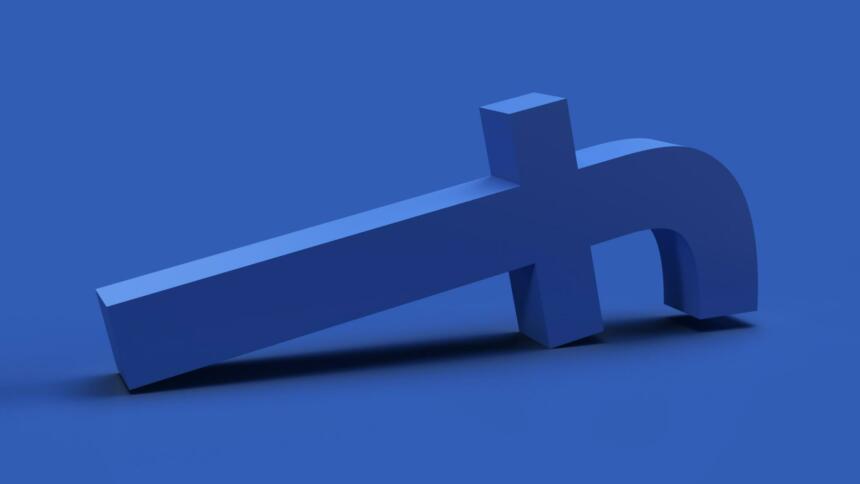
Julia Reda saß von 2014 bis 2019 für die Piraten im Europäischen Parlament und verantwortet heute bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte das Projekt „control c“ zu Urheberrecht und Kommunikationsfreiheit. Dieser Beitrag erschien zuerst in ihrer Kolumne auf heise.de und wurde dort unter der Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht.
Facebook hat eine katastrophale Woche hinter sich. Der Totalausfall der Plattform, inklusive der Dienste WhatsApp und Instagram, legte am vergangenen Montag für mehrere Stunden die Kommunikation großer Teile der Weltbevölkerung, inklusive vieler kleiner Unternehmen und selbst einiger Behörden lahm.
Nur wenige Tage später warf die Aussage der Whistleblowerin und ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen vor dem US-Kongress ein Schlaglicht auf die Macht, die Facebooks Empfehlungsalgorithmen auf ihre Nutzer:innen ausüben. Dennoch droht diese Schockwelle ohne ernstliche politische Folgen zu verhallen.
Aufrufe, auf alternative soziale Netzwerke und Messenger-Dienste auszuweichen, um unsere Abhängigkeit von dem Unternehmen zu reduzieren, sind absolut berechtigt, aber gehen am Kern des Problems vorbei. Für große Teile der Bevölkerung, die ihren Arbeitsalltag nicht im Netz verbringen, wirken Alternativen zu Facebook nach wie vor unerreichbar. Der Ausfall der Dienste war schnell genug wieder behoben, dass wohl nur wenige Frisörsalons statt einer Facebook-Seite nun eine eigene Webseite aufbauen werden, kaum ein Handwerksbetrieb wird seine Terminabsprachen von WhatsApp auf Signal umziehen.
Kaum jemand wird Instagram wegen Haugens Enthüllungen über dessen unethische und intransparente Inhaltemoderation den Rücken kehren, zumal die Situation bei Konkurrenzunternehmen wie TikTok nicht besser ist. Die Unternehmensentscheidungen von Facebook beeinflussen so auch diejenigen, die seine Dienste bewusst nicht nutzen.
Lektionen für europäische Gesetzgeber
Wenn wir wollen, dass die Ereignisse der vergangenen Woche spürbare Folgen haben und den Einfluss Facebooks eindämmen, müssen wir auf Regulierung setzen. Damit tut sich die US-Regierung seit langem schwer – noch immer fehlt den USA ein landesweiter Mindeststandard für den Datenschutz und in den wenigen Bereichen, in denen föderale Internetregulierung verabschiedet wurde, hat sich diese eher als schädlich für die Grundrechte der Nutzer:innen herausgestellt.
Doch die Europäische Union arbeitet aktuell mit dem Digital Services Act an einem umfangreichen Regelwerk für Online-Plattformen, das zumindest das Potential hat, mehr Macht über unsere Kommunikation wieder in die Hände der Nutzer:innen zu legen.
Wie sieht also eine angemessene Reaktion auf die jüngsten Skandale aus? Zunächst muss nach dem Facebook-Ausfall klar sein, dass wir die Verantwortung über kritische Kommunikationsinfrastruktur nicht allein wenigen großen Internetunternehmen überlassen dürfen. Der Staat hat nicht nur eine Verantwortung für die Förderung von gemeinwohlorientierten Alternativen zu kommerziellen Messengern, sondern auch für die Instandhaltung der vielen auf Freier Software basierenden Basistechnologien, auf die unsere Kommunikation aufbaut – von Code-Libraries über offene Standards und Protokolle.
Eine geeignete Förderinfrastruktur für diese oft von Freiwilligen gestemmten Projekte gehört unbedingt in den Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung, wie es auch der Chaos Computer Club fordert.
Infrastrukturanbieter sind keine Internetpolizei
Als Facebooks Server nicht mehr erreichbar waren, erhöhte sich schlagartig die Last auf alle möglichen Internetdienste – nicht nur auf alternative soziale Netzwerke wie Twitter, sondern beispielsweise auch auf von Facebook gänzlich unabhängige DNS-Resolver, die mit Anfragen zu den nicht mehr erreichbaren Webseiten überhäuft wurden. Zwar können sich DNS-Dienste durch vorausschauende Konfiguration ihrer Systeme vor derartigen Belastungen schützen, doch auch das erfordert Ressourcen.
Anstatt gemeinwohlorientierte Internetdienste wie DNS-Resolver mit Haftungsrisiken für Urheberrechtsverletzungen Dritter zu bedrohen, sollte der Staat diese unterstützen. Die Europäische Union kann den Digital Services Act dafür nutzen, ein für alle mal klarzustellen, was nach dem Facebook-Ausfall auch für technische Lai:innen offensichtlich sein sollte: DNS-Dienste sind ein integraler Bestandteil eines jeden Internetzugangs – wenn die DNS-Auflösung überlastet ist, kann ich Webseiten nicht aufrufen und das Internet nicht sinnvoll nutzen. Daraus folgt auch, dass DNS-Dienste – anders als in einer einstweligen Verfügung des Landgerichts Hamburg gegen den DNS-Resolver Quad9 angenommen – selbstverständlich unter den Haftungsausschluss für Internetzugangsanbieter fallen müssen. Diese Rechtsauffassung bestätigt der Gesetzesentwurf der EU-Kommission für den Digital Services Act. Europaparlament und Rat müssen sich dieser Klarstellung anschließen, um IT-Infrastrukturanbieter zu schützen.
Auch die Netzneutralität ist ein wichtiger globaler Garant für unabhängige Infrastruktur. Länder, in denen Facebook mit Internetzugangsanbietern sogenannte Zero-Rating-Deals abgeschlossen hat, waren von dem Ausfall von WhatsApp und Co. besonders hart getroffen, weil der Datenverkehr über diese Dienste für die Kund:innen der Telekomanbieter in diesen Ländern kostenfrei ist – im Gegensatz zu alternativen Diensten wie Signal. Wer sich kein Datenvolumen leisten kann, war also ohne Vorwarnung von der Kommunikation abgeschnitten.
Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich Zero-Rating-Angebote von Telekomanbietern wie Telekom und Vodafone für unzulässig erklärt. Telekom-Regulierungsbehörden müssen nun ihren Job machen und ähnliche Zero-Rating-Angebote vom europäischen Markt verbannen. Außerdem täte die EU gut daran, sich auf globaler Ebene genauso intensiv für die Netzneutralität einzusetzen, wie sie dort die Wirtschaftsinteressen europäischer Medienkonzerne vertritt.
Forschung muss Facebook unter die Motorhaube schauen
Die zentrale Botschaft der Whistleblowerin Frances Haugen an den US-Kongress war: Internetregulierung kann nur dann funktionieren, wenn der Öffentlichkeit belastbare Forschungsergebnisse über die Funktionsweise der großen Plattformen vorliegen. Damit trifft sie einen wunden Punkt – die Intransparenz der Internetkonzerne über ihre Moderationspraxis macht die Politik anfällig für die Forderungen von Lobbygruppen, die durch grundrechtsfeindliche Gesetze wie verpflichtende Uploadfilter einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen.
Auch das Europaparlament droht erneut in diese Falle zu tappen, der mitberatende Rechtsausschuss fordert beim Digital Services Act etwa, dass Plattformen die Sperrung von Inhalten an „vertrauenswürdige Hinweisgeber“ delegieren sollen (damit sind vermutlich Hollywoodstudios gemeint) und den Wiederupload von einmal gesperrten Inhalten verhindern sollen.
Der Ausschuss beteuert, dies sei ohne Einsatz von Uploadfiltern möglich und demonstriert damit erneut seine digitalpolitische Planlosigkeit, die er bereits in der letzten Legislaturperiode bei der Urheberrechtsreform ausgiebig unter Beweis gestellt hat.
Wie kann eine wissenschaftlich fundierte Faktenbasis für die Regulierung von Unternehmen wie Facebook also funktionieren, die ihre interne Forschung über die katastrophalen Folgen ihrer Moderationsalgorithmen für den gesellschaftlichen Diskurs unter Verschluss halten? Sicherlich ist der Schutz von Whistleblowerinnen wie Haugen, die zahlreiche dieser Studien an die Öffentlichkeit gebracht hat, ein Schritt in die richtige Richtung.
Die kommende Bundesregierung muss also dringend die europäische Whistleblowing-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Gelingt ihr das nicht bis Dezember, was angesichts der noch laufenden Sondierungen bereits jetzt ein Ding der Unmöglichkeit sein dürfte, droht Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren der EU. Es ist ein klares Versäumnis der scheidenden schwarz-roten Bundesregierung, dass es so weit kommen konnte.
Wir dürfen uns bei der Erforschung von Inhaltemoderation auf Plattformen wie Facebook aber nicht länger rein auf die Zivilcourage von Whistleblower:innen verlassen. Es braucht endlich europaweite, einklagbare Rechtsansprüche von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Journalist:innen auf Datenzugang, damit Forschung über die Moderation von Inhalten im Lichte der Öffentlichkeit an unabhängigen Institutionen stattfinden kann. Eine neue Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von Prof. Louisa Specht-Riemenschneider gibt Aufschluss darüber, wie solche Rechtsansprüche aussehen müssen.
Einen ersten Ansatz gibt es dazu im neuen deutschen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz, das zumindest Forschungseinrichtungen Einblick in die Nutzung von Uploadfiltern im Urheberrecht geben soll. Den Digital Services Act gilt es aber unbedingt zu nutzen, um einen solchen Rechtsanspruch auf europäischer Ebene zu verankern und einem größeren Berechtigtenkreis zuzusichern. Andernfalls kann Facebook unliebsame eigene Erkenntnisse über seine Moderationspraxis weiter verheimlichen und unabhängige zivilgesellschaftliche Forschung durch Drohungen und technische Sperrungen zunichtemachen.
Hilf mit! Mit Deiner finanziellen Hilfe unterstützt Du unabhängigen Journalismus.
0 Commentaires